Eigentumswohnung kaufen was ist zu beachten
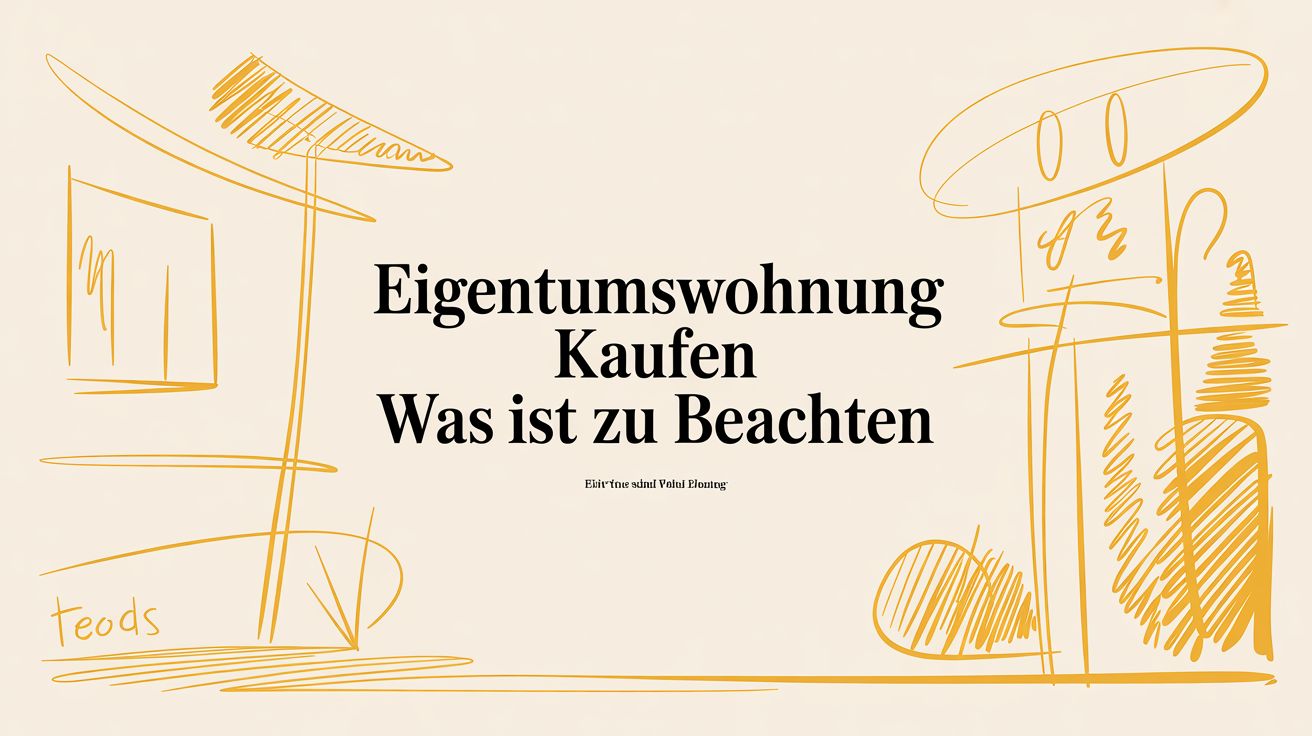
Der Kauf einer Eigentumswohnung ist eine der größten finanziellen Weichenstellungen im Leben. Genau deshalb ist es so wichtig, die Sache richtig anzugehen und die entscheidenden Punkte zu kennen. Es geht um weit mehr als nur den Kaufpreis – vom genauen Blick auf den baulichen Zustand über das Wälzen von Gemeinschaftsdokumenten bis hin zu einer Finanzierung, die wirklich auf soliden Füßen steht. Wer hier seine Hausaufgaben macht, schützt sich vor bösen und teuren Überraschungen und schafft die Basis für ein sicheres Zuhause.
Der weg zur eigenen wohnung: Die wichtigsten prüfpunkte
Der Weg in die eigenen vier Wände kann sich manchmal wie eine Expedition anfühlen. Ohne eine gute Karte verläuft man sich schnell. Bevor wir also tief in die Details eintauchen, verschaffen wir uns erst einmal einen Überblick über die wichtigsten Stationen auf dieser Reise. Jede einzelne Etappe hat ihre eigenen Tücken, aber auch ihre Chancen, die am Ende über den Erfolg Ihrer Investition entscheiden.
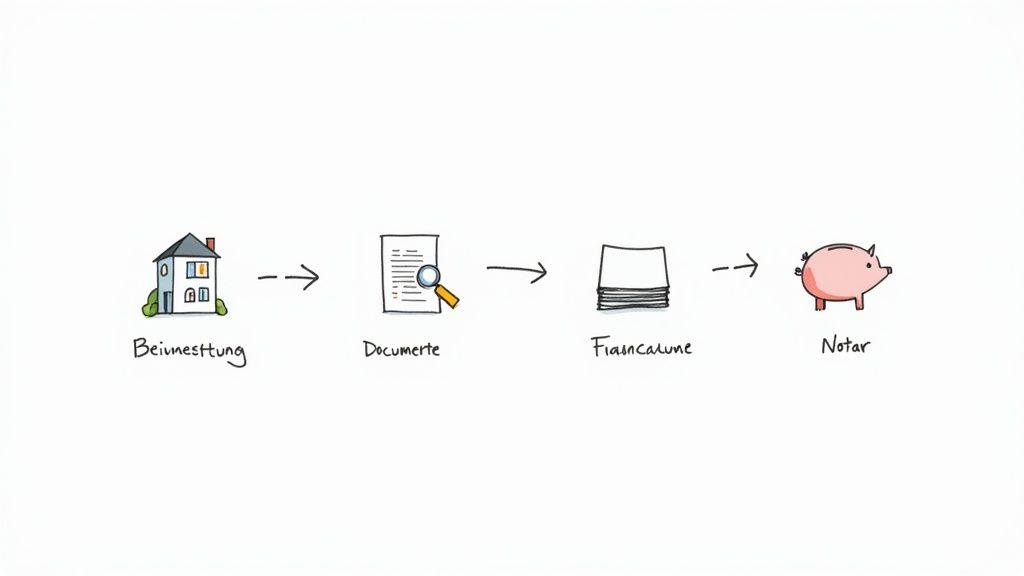
Man kann den gesamten Kaufprozess in ein paar Kernbereiche unterteilen, die Sie systematisch abarbeiten sollten. Das fängt bei der Immobilie selbst an und hört bei den rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen auf.
Die grundlagen des wohnungskaufs verstehen
Ein entscheidender erster Schritt? Verstehen, was auf dem Markt gerade los ist. Wer in Deutschland eine Eigentumswohnung sucht, kommt nicht umhin, sich mit der Preisentwicklung zu beschäftigen. Im dritten Quartal lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Bestandswohnungen bei 2.549 Euro – ein leichter Anstieg von 0,2 % im Vergleich zum Vorquartal.
In den Metropolen sieht das Bild natürlich ganz anders aus: In München werden im Schnitt stolze 8.200 Euro pro Quadratmeter fällig. Für eine typische Wohnung mit rund 83 Quadratmetern liegt die durchschnittliche Kaufsumme bei etwa 287.646 Euro. Diese Zahlen zeigen, wie riesig die regionalen Unterschiede sind und warum eine präzise Budgetplanung das A und O ist.
Aber Achtung: Der Kaufpreis ist nur die halbe Miete. Die wahren Kosten beinhalten auch die Kaufnebenkosten. Die können, je nach Bundesland, noch einmal bis zu 15 % des Kaufpreises obendrauf packen.
Ein Faktor, der oft unterschätzt wird, sind die laufenden Kosten, die nach dem Einzug auf Sie zukommen. Das monatliche Hausgeld – das nicht nur Betriebskosten, sondern auch die Einzahlung in die Instandhaltungsrücklage abdeckt – hat einen enormen Einfluss auf Ihre monatliche Belastung.
Die zentralen prüfbereiche im überblick
Damit Sie bei all den Dokumenten und Besichtigungen nicht den Faden verlieren, ist eine klare Struktur Gold wert. Die folgenden Punkte sind quasi die Eckpfeiler für eine fundierte und sichere Kaufentscheidung.
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Bereiche, die Sie sich ganz genau ansehen müssen. Betrachten Sie sie als Ihre persönliche Roadmap, um keine bösen Überraschungen zu erleben.
| Prüfpunkt | Worauf sie achten sollten |
|---|---|
| Baulicher Zustand | Substanz von Fenstern, Dach, Heizung, Elektrik; Anzeichen für Feuchtigkeit oder Schimmel; energetischer Zustand des Gebäudes. |
| Rechtliche Dokumente (WEG) | Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung, Protokolle der Eigentümerversammlungen (mind. 3-5 Jahre), aktueller Wirtschaftsplan. |
| Finanzen der WEG | Höhe der Instandhaltungsrücklage, geplante Sonderumlagen, Höhe des monatlichen Hausgeldes, eventuelle Zahlungsrückstände anderer Eigentümer. |
| Eigene Finanzierung | Belastbare Finanzierungszusage der Bank, realistische Einschätzung der monatlichen Belastung, ausreichend Eigenkapital für Kaufnebenkosten. |
| Kaufvertrag & Notar | Sorgfältige Prüfung des Kaufvertragsentwurfs (idealerweise durch einen Experten), Klärung aller offenen Fragen vor dem Notartermin. |
Jeder dieser Punkte ist ein kleines Projekt für sich. Nehmen Sie sich die Zeit, jeden Bereich gründlich zu durchleuchten – es wird sich auszahlen.
Jeder dieser Bereiche hat es in sich und wird in den folgenden Kapiteln noch genauer beleuchtet. Wenn Sie jetzt schon tiefer einsteigen möchten, finden Sie weitere nützliche Checklisten und Informationen in unserem umfangreichen Ratgeber.
Die Immobilie auf Herz und Nieren prüfen
Der Kauf einer Eigentumswohnung ist eine große Entscheidung. Die Besichtigung ist dabei viel mehr als nur ein erster Eindruck – sie ist Ihre wichtigste Chance, hinter die Kulissen zu schauen und die Immobilie gründlich zu prüfen. Wer hier strategisch vorgeht, verwandelt einen einfachen Rundgang in eine fundierte Inspektion und schützt sich so vor bösen und teuren Überraschungen.

Nehmen Sie sich für den Termin unbedingt ausreichend Zeit. Am besten, Sie vereinbaren ihn bei Tageslicht. Dann fallen Mängel viel deutlicher auf als im Dämmerlicht mit künstlicher Beleuchtung. Außerdem bekommen Sie ein ehrliches Gefühl für die Helligkeit und die Atmosphäre in den Räumen.
Bausubstanz und technische Ausstattung kritisch bewerten
Die Substanz des Gebäudes ist das Fundament Ihrer Investition. Sie entscheidet darüber, ob der Wert der Wohnung langfristig steigt und welche Kosten in Zukunft auf Sie zukommen. Fangen Sie Ihre Prüfung bei den Dingen an, die man leicht übersieht.
Fenster und Türen sind ein perfekter Startpunkt. Fühlen sich die Rahmen dicht an? Sehen Sie Risse oder gar morsche Stellen? Werfen Sie einen Blick auf das Baujahr, das oft im Rahmen eingeprägt ist. Fenster aus den 90er-Jahren oder sogar noch älter sind echte Energiefresser und ein klares Zeichen dafür, dass hier bald Sanierungskosten anstehen.
Ein kritischer Blick auf Wände und Decken ist unverzichtbar. Halten Sie Ausschau nach Wasserflecken, Verfärbungen oder abblätternder Farbe. Besonders in Ecken, hinter großen Möbeln und rund um Bad und Küche sollten Sie genau hinschauen. Solche Spuren sind oft Alarmsignale für Feuchtigkeit – eine der kostspieligsten Fallen beim Wohnungskauf.
Auch die Technik im Inneren braucht Ihre volle Aufmerksamkeit. Ein Blick in den Sicherungskasten verrät oft mehr als tausend Worte. Wenn dort noch alte Schraubsicherungen zu finden sind, ist die gesamte Elektrik vermutlich veraltet und erfüllt die heutigen Sicherheitsstandards nicht mehr. Fragen Sie gezielt nach, wann Elektrik und Wasserleitungen zuletzt erneuert wurden. Als Faustregel gilt: Nach 20 bis 30 Jahren ist hier meist eine Modernisierung fällig.
Die richtigen Fragen stellen und gezielt nachhaken
Was Sie selbst sehen, ist die eine Sache. Die richtigen Fragen an den Verkäufer oder Makler zu stellen, ist die andere. Eine gute Vorbereitung macht hier den Unterschied und hilft Ihnen, das Gesamtbild zu vervollständigen.
Machen Sie sich am besten eine Liste mit Fragen, die über die Standardinfos im Exposé hinausgehen. Das zeigt nicht nur ernsthaftes Interesse, sondern liefert Ihnen auch die wirklich wichtigen Informationen.
- Geplante Sanierungen: Wurden in letzter Zeit größere Arbeiten am Gemeinschaftseigentum (Dach, Fassade, Heizung) erledigt oder steht etwas an?
- Bekannte Mängel: Gibt es bekannte Schwachstellen, die man im Kaufvertrag festhalten sollte? Das können Hellhörigkeit sein oder wiederkehrende Feuchtigkeitsprobleme.
- Grund für den Verkauf: Warum wird die Wohnung verkauft? Manchmal gibt die Antwort darauf Hinweise auf Probleme mit dem Haus oder der Nachbarschaft.
- Umbauten: Wurden in der Wohnung tragende Wände entfernt oder andere größere Umbauten vorgenommen, für die es eine Genehmigung gebraucht hätte?
Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie sich unbedingt notieren. Ein detailliertes Protokoll Ihrer Beobachtungen und der Gespräche ist später Gold wert. Eine gute Grundlage dafür finden Sie in unserem Leitfaden zum Abnahmeprotokoll für Wohnungen als PDF, den Sie als Checkliste anpassen können.
Wann ein Bausachverständiger unerlässlich ist
Selbst bei der gründlichsten Vorbereitung bleiben viele potenzielle Mängel für das ungeübte Auge unsichtbar. Gerade bei älteren Gebäuden oder wenn Sie bei der Besichtigung erste Warnsignale entdeckt haben, ist das Geld für einen Bausachverständigen eine wirklich gute Investition.
Ein Gutachter geht professionell vor und kann versteckte Mängel wie Asbest, verdeckten Schimmel oder statische Probleme aufdecken, die Sie niemals selbst gefunden hätten. Die Kosten für ein solches Gutachten liegen meist zwischen 500 und 1.500 Euro. Das klingt erstmal viel, ist aber verschwindend gering im Vergleich zu den Sanierungskosten, die schnell im fünfstelligen Bereich landen können.
Mit der Expertise eines Profis in der Hand haben Sie eine starke Basis für Preisverhandlungen. Oder Sie können im schlimmsten Fall rechtzeitig von einem problematischen Kauf Abstand nehmen. Diese zusätzliche Sicherheit ist ein entscheidender Baustein für einen erfolgreichen und sorgenfreien Wohnungskauf.
Die Gemeinschaft verstehen: Ein Blick hinter die Kulissen der WEG-Dokumente
Wer eine Eigentumswohnung kauft, erwirbt weit mehr als nur die eigenen vier Wände. Sie werden automatisch Teil einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Stellen Sie sich das wie eine Zwangsgemeinschaft vor, in der alle Eigentümer gemeinsam für das gesamte Gebäude geradestehen. Ein gutes Miteinander und eine solide finanzielle Basis sind hier das A und O – nicht nur für Ihre Lebensqualität, sondern auch für den Werterhalt Ihrer Immobilie.

Deshalb ist es absolut entscheidend, vor dem Kauf einen genauen Blick in die "Verfassung" dieser Gemeinschaft zu werfen. Die wichtigsten Informationen stecken in Dokumenten, die für Laien oft wie ein Buch mit sieben Siegeln wirken. Aber keine Sorge: Mit dem richtigen Know-how lernen Sie schnell, zwischen den Zeilen zu lesen und zu verstehen, worauf Sie sich wirklich einlassen.
Die Teilungserklärung: Was gehört Ihnen wirklich?
Die Teilungserklärung ist das Grundgesetz jeder WEG. Sie definiert klipp und klar, welche Teile des Gebäudes und Grundstücks Ihr Privateigentum sind und welche der Gemeinschaft gehören. Man muss hier zwei ganz zentrale Begriffe auseinanderhalten:
- Sondereigentum: Das ist alles, was ausschließlich Ihnen gehört und worüber Sie (fast) nach Belieben bestimmen können. Typischerweise sind das die Wohnung selbst, nicht tragende Innenwände, Bodenbeläge, die sanitären Anlagen und oft auch ein Kellerraum oder ein Teil des Dachbodens.
- Gemeinschaftseigentum: Hierzu zählt alles, was für den Bestand und die Sicherheit des Gebäudes unerlässlich ist oder von allen Eigentümern genutzt wird. Klassische Beispiele sind das Dach, die Fassade, das Treppenhaus, tragende Wände, Fenster und die Heizanlage.
Diese Trennung hat ganz konkrete finanzielle Folgen. Für Ihr Sondereigentum sind Sie allein verantwortlich und tragen auch die Kosten. Reparaturen am Gemeinschaftseigentum hingegen werden von allen Eigentümern gemeinsam bezahlt, in der Regel über das monatliche Hausgeld.
Ein klassischer Streitpunkt sind Balkone oder Terrassen. Oft gehören sie rechtlich zum Gemeinschaftseigentum, an dem Sie lediglich ein Sondernutzungsrecht haben. Das heißt: Sie dürfen den Bereich allein nutzen, müssen sich bei baulichen Veränderungen aber strikt an die Vorgaben der Gemeinschaft halten.
Protokolle der Eigentümerversammlungen: Die ungeschminkte Wahrheit
Während die Teilungserklärung die starren Regeln vorgibt, sind die Protokolle der Eigentümerversammlungen aus den letzten drei bis fünf Jahren das lebendige Tagebuch der WEG. Hier bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie der Hase wirklich läuft. Achten Sie beim Durchsehen gezielt auf wiederkehrende Themen.
Wird immer wieder über dieselben Reparaturen gestritten, ohne dass etwas geschieht? Das kann ein Warnsignal für einen Sanierungsstau oder eine zerstrittene Gemeinschaft sein. Gibt es ständig Zoff wegen der Hausordnung, Lärm oder der Kostenverteilung? Dann ist das Klima unter den Nachbarn möglicherweise vergiftet.
Die Protokolle verraten Ihnen auch, welche großen Projekte in naher Zukunft anstehen. Ist eine teure Dachsanierung oder eine neue Fassade geplant, müssen Sie prüfen, ob die Instandhaltungsrücklage dafür ausreicht. Wenn nicht, drohen Ihnen als neuem Eigentümer empfindliche Sonderumlagen. Bei solch kniffligen Fragen ist es oft Gold wert, einen Profi an seiner Seite zu haben. Mehr dazu, wie ein Sachverständiger beim Hauskauf helfen kann, erfahren Sie in unserem weiterführenden Artikel.
Diese Unterlagen zeichnen ein ehrliches Bild von der finanziellen und sozialen Verfassung der WEG. Der Immobilienmarkt ist hart, keine Frage. Laut einer Studie planen rund 2,51 Millionen Menschen in Deutschland, in den nächsten ein bis zwei Jahren eine Eigentumswohnung zu kaufen. Dieser Druck verleitet dazu, schnell zuzuschlagen. Doch gerade die sorgfältige Prüfung der WEG-Dokumente bewahrt Sie vor bösen und teuren Überraschungen.
Die wahren Kosten kalkulieren: Hausgeld und Instandhaltungsrücklage
Der Kaufpreis und die Notarkosten sind gestemmt – man könnte meinen, der größte finanzielle Brocken auf dem Weg zur eigenen Wohnung ist geschafft. Doch Achtung: Was viele unterschätzen, sind die laufenden Kosten. Diese „zweite Miete“ entscheidet darüber, wie hoch Ihre monatliche Belastung wirklich ausfällt und sollte Ihre volle Aufmerksamkeit bekommen, um böse Überraschungen zu vermeiden.
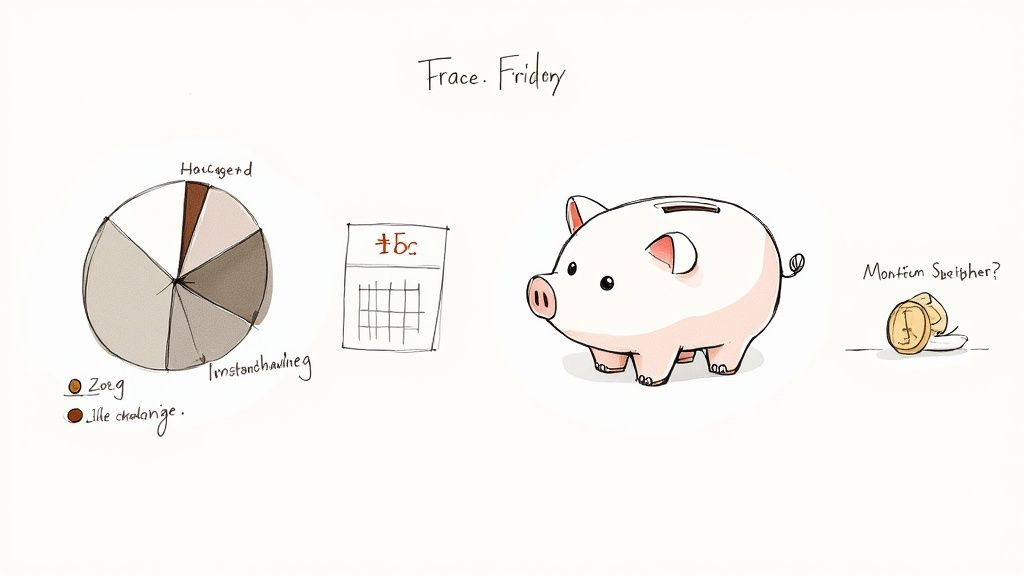
Zwei Begriffe stehen hier im Mittelpunkt, und die müssen Sie als zukünftiger Eigentümer im Schlaf kennen: das Hausgeld und die Instandhaltungsrücklage. Beide sind fest mit dem Leben in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) verknüpft und ein entscheidender Gradmesser für die finanzielle Gesundheit Ihrer zukünftigen Immobilie.
Das Hausgeld verstehen: Mehr als nur Betriebskosten
Das Hausgeld ist eine monatliche Vorauszahlung, die jeder Eigentümer an die Hausverwaltung überweist. Es deckt alle Kosten ab, die für den Betrieb und die Pflege des Gemeinschaftseigentums anfallen. Man kann es sich grob wie die Nebenkostenabrechnung für Mieter vorstellen, aber der Umfang ist deutlich größer.
Ein guter Teil davon sind die klassischen Betriebskosten, die Ihnen bekannt vorkommen dürften:
- Wasser und Abwasser: Kosten für den gemeinsamen Wasserverbrauch und dessen Entsorgung.
- Heizung und Warmwasser: Zumindest, wenn eine Zentralheizung für das ganze Haus existiert.
- Müllabfuhr: Die Gebühren für die Tonnen vor der Tür.
- Gebäudeversicherung und Haftpflicht: Unerlässlich, um das Gemeinschaftseigentum vor Schäden zu schützen.
- Hausmeisterdienste: Alles von der Treppenhausreinigung über die Gartenpflege bis zum Winterdienst.
- Verwaltungskosten: Das Honorar für die Arbeit der Hausverwaltung.
Das ist aber noch nicht die ganze Geschichte. Der wirklich entscheidende Posten, der das Hausgeld von reinen Nebenkosten unterscheidet, ist die Zuführung zur Instandhaltungsrücklage.
Die Instandhaltungsrücklage: Der finanzielle Schutzschild der WEG
Stellen Sie sich die Instandhaltungsrücklage wie ein gemeinsames Sparkonto aller Eigentümer vor. Ein festgelegter Teil Ihres monatlichen Hausgeldes fließt direkt dorthin. Wofür? Um für die großen, teuren Reparaturen und Modernisierungen am Gemeinschaftseigentum gewappnet zu sein. Wir reden hier nicht von einer kaputten Glühbirne im Flur, sondern von Kalibern wie einer Dachsanierung, einer neuen Fassade, dem Austausch der kompletten Heizungsanlage oder der Renovierung des Treppenhauses. Solche Maßnahmen können schnell Zehntausende oder sogar Hunderttausende Euro verschlingen.
Eine gut gefüllte Instandhaltungsrücklage ist die beste Versicherung gegen plötzliche, hohe Sonderumlagen. Fehlt dieses Polster, müssen unvorhergesehene Reparaturen direkt von den Eigentümern bezahlt werden – und das kann einen schnell an die finanziellen Grenzen bringen.
Ein mickriges Sparkonto ist deshalb ein massives Warnsignal. Es kann auf einen handfesten Sanierungsstau hindeuten und birgt das Risiko, dass Sie als neuer Eigentümer bald für die Versäumnisse der Vergangenheit zur Kasse gebeten werden.
Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung: So deuten Sie die Zahlen richtig
Um herauszufinden, wie es finanziell um die WEG bestellt ist, gibt es zwei unverzichtbare Dokumente: den aktuellen Wirtschaftsplan und die letzte Jahresabrechnung. Der Wirtschaftsplan ist quasi die Prognose für das kommende Jahr. Er listet alle erwarteten Einnahmen und Ausgaben auf und legt so die Höhe Ihres monatlichen Hausgeldes fest.
Die Jahresabrechnung ist der Kassensturz danach. Sie zeigt, was tatsächlich ausgegeben wurde und ob die Vorauszahlungen gereicht haben. Gab es hohe Nachzahlungen? Das kann ein klares Indiz für eine zu knappe Kalkulation sein.
Nehmen Sie sich diese Unterlagen genau vor und achten Sie auf diese Punkte:
- Höhe der Rücklage: Als Faustregel gilt eine jährliche Ansparung von etwa 0,8 % bis 1,0 % des reinen Gebäudewertes. Je älter das Gebäude, desto höher sollte der Wert angesetzt sein.
- Kostenverteilung: Ist klar ersichtlich, wie die Kosten auf die einzelnen Eigentümer verteilt werden? Ist das fair und nachvollziehbar?
- Kostenentwicklung: Gibt es Posten, die in den letzten Jahren unerklärlich in die Höhe geschossen sind?
- Zahlungsmoral: Finden sich in den Protokollen Hinweise darauf, dass einzelne Eigentümer ihr Hausgeld unregelmäßig oder gar nicht zahlen? Das kann die ganze Gemeinschaft belasten.
Vergessen Sie neben Hausgeld und Rücklage auch nicht die notwendigen Versicherungen für Ihr Sondereigentum. Es lohnt sich, hier Angebote genau zu prüfen. Auf Portalen können Sie Versicherungen clever vergleichen und so auch diese langfristige finanzielle Belastung von Anfang an korrekt einplanen.
Finanzierung sichern und Kaufvertrag prüfen
Der Weg zur eigenen Wohnung steht und fällt mit einer soliden Finanzierung. Bevor Sie sich überhaupt auf die Suche machen, sollten Sie glasklar wissen, was Sie sich leisten können. Für die meisten bedeutet das: ab zur Bank und eine Kreditzusage einholen.
Ohne Eigenkapital wird es schwierig. Es ist das Fundament, auf dem Ihre gesamte Finanzierung aufbaut. Eine gute Faustregel ist, mindestens 20 % des Kaufpreises plus die Nebenkosten aus eigener Tasche zu zahlen. Weniger Eigenkapital bedeutet nicht nur höhere Zinsen, sondern oft auch zähere Verhandlungen mit der Bank.
Die Finanzierung richtig aufsetzen
Bevor Sie auch nur ein einziges Kreditangebot einholen, müssen Sie Ihre Hausaufgaben machen. Rechnen Sie ehrlich aus, wie hoch Ihre monatliche Belastung maximal sein darf. Ein guter Richtwert ist, nicht mehr als 35 % des gemeinsamen Nettoeinkommens für die Rate einzuplanen. Und ganz wichtig: Legen Sie immer etwas für unvorhergesehene Ausgaben zurück. Man weiß ja nie.
Banken werfen gerne mit Begriffen wie Annuitätendarlehen, Tilgungsdarlehen oder variablem Darlehen um sich. Lassen Sie sich davon nicht beeindrucken. Jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile, die zu Ihrer Lebensplanung passen müssen. Achten Sie vor allem auf die Dauer der Zinsbindung und ob Sie zwischendurch Sondertilgungen leisten können, um schneller schuldenfrei zu werden.
Die Wahl der Bank kann am Ende über Tausende von Euro entscheiden. Die Hausbank um die Ecke mag mit persönlicher Beratung glänzen, doch reine Onlinebanken haben oft die besseren Konditionen.
Ein früher und breiter Vergleich ist Gold wert. Wer sich hier Zeit nimmt, sichert sich oft die deutlich besseren Konditionen und spart über die Jahre eine Menge Geld.
Die Zahlen hinter dem Kredit
Beim Wohnungskauf in Deutschland geht es schnell um große Summen. Das durchschnittliche Investitionsvolumen liegt bei etwa 360.000 Euro. Die wenigsten haben das auf der hohen Kante. Im Schnitt werden satte 87 Prozent über einen Kredit finanziert.
Nachdem die Zinsen jahrelang im Keller waren, liegen sie für Immobilienkredite aktuell bei rund 4,0 Prozent. Das macht eine sorgfältige Planung und einen ehrlichen Blick auf die eigenen Finanzen wichtiger denn je. Die vollständigen Ergebnisse finden Sie in der aktuellen Sparda-Wohnstudie. Hier geht’s zur Studie
Den Kaufvertragsentwurf unter die Lupe nehmen
Sobald die Finanzierung steht, flattert der Entwurf des Kaufvertrags vom Notar ins Haus. Nehmen Sie sich Zeit, dieses Dokument in Ruhe zu prüfen. Der Notar ist zwar neutral, aber er kennt weder Sie noch die Immobilie im Detail.
Lesen Sie das Kleingedruckte, besonders bei Klauseln zur Gewährleistung. Gibt es bekannte Mängel, müssen die Fristen für deren Beseitigung klar geregelt sein. Achten Sie auch auf den Übergabetermin und die sogenannte Lastenfreistellung – die Wohnung gehört erst dann wirklich Ihnen, wenn alle alten Grundschulden des Verkäufers aus dem Grundbuch gelöscht sind.
Die Kaufnebenkosten sind ein weiterer wichtiger Punkt im Vertrag. Während Grunderwerbsteuer und Notarkosten feststehen, lässt sich über die Maklerprovision oft noch reden. Ein klares Datum für den Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten schützt beide Seiten vor bösen Überraschungen.
Checkliste für den Vertrags-Check:
- Gewährleistung: Sind Klauseln zum Haftungsausschluss verständlich und fair?
- Übergabe: Ist der Termin für den Besitzübergang klar und realistisch?
- Mängel: Gibt es eine Regelung zu Nachbesserungen oder ein Abnahmeprotokoll?
- Zahlung: Sind alle Zahlungsmodalitäten und Fristen eindeutig festgehalten?
Ein kurzer Blick auf gängige Darlehensarten:
| Darlehensart | Der große Vorteil | Der Haken |
|---|---|---|
| Annuitätendarlehen | Gleichbleibende Rate, super planbar | Wenig flexibel durch lange Zinsbindung |
| Tilgungsdarlehen | Man ist schneller schuldenfrei | Die Rate ist am Anfang sehr hoch |
| Variables Darlehen | Man profitiert von sinkenden Zinsen | Zinsanstiege schlagen voll durch |
Mit einem Annuitätendarlehen haben Sie maximale Planungssicherheit. Ein paar gut verhandelte Sondertilgungsrechte geben Ihnen zusätzlich die Flexibilität, bei einem Geldsegen die Restschuld schneller zu senken. Hier kommt übrigens auch bau24 wieder ins Spiel: Wenn Sie bei der Besichtigung Mängel dokumentiert haben, stärkt das Ihre Position für eventuelle Nachverhandlungen beim Kaufpreis.
Die Nebenkosten nicht vergessen:
- Grunderwerbsteuer: Je nach Bundesland 3,5 % bis 6,5 % des Kaufpreises
- Notar & Grundbuch: Rechnen Sie mit ca. 2 %
- Maklerprovision: Üblich sind 3,57 % bis 7 %
- Puffer: Planen Sie unbedingt Reserven für Renovierungen und die neue Einrichtung ein!
Souverän durch den Notartermin
Zum großen Tag bringen Sie nur Ihren Personalausweis und die Finanzierungszusage der Bank mit. Der Termin selbst ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Der Notar liest den gesamten Vertrag Wort für Wort vor. Nutzen Sie die Gelegenheit! Wenn Ihnen etwas unklar ist, fragen Sie sofort nach. Genau dafür ist der Notar da.
Ist alles geklärt und unterschrieben, veranlasst der Notar die Eintragung der Auflassungsvormerkung im Grundbuch. Das ist quasi die offizielle Reservierung der Wohnung für Sie. Ab diesem Moment kann der Verkäufer keinen Rückzieher mehr machen.
Die häufigsten Fragen rund um den Wohnungskauf
Der Traum von den eigenen vier Wänden ist zum Greifen nah, doch auf dem Weg dorthin tauchen oft noch einige Fragen auf. Das ist völlig normal. In diesem letzten Abschnitt gehen wir auf die häufigsten Unsicherheiten ein, die Kaufinteressenten immer wieder beschäftigen. Betrachten Sie es als Ihren persönlichen Wissensvorsprung, um die letzten Hürden souverän zu nehmen.
Was passiert bei Mängeln, die erst nach dem Kauf auftauchen?
Das ist wohl die größte Sorge vieler Käufer: Man zieht ein und entdeckt plötzlich ein Problem, von dem nie die Rede war. Grundsätzlich gilt beim Immobilienkauf der Grundsatz: „Gekauft wie gesehen“. Im Notarvertrag wird die Gewährleistung für Sachmängel fast immer ausgeschlossen.
Eine entscheidende Ausnahme gibt es aber: wenn der Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen hat. Das heißt, er wusste ganz genau von dem undichten Dach oder dem feuchten Keller, hat es Ihnen aber bewusst verschwiegen. In so einem Fall haben Sie auch Jahre nach dem Kauf noch Handhabe.
Ihre möglichen Ansprüche sind dann:
- Nacherfüllung: Der Verkäufer muss den Schaden auf seine Kosten beheben lassen.
- Minderung des Kaufpreises: Sie können einen Teil des Geldes zurückverlangen.
- Schadensersatz: Sind Ihnen durch den Mangel weitere Kosten entstanden, zum Beispiel für ein Hotel während der Sanierung, muss der Verkäufer dafür aufkommen.
- Rücktritt vom Kaufvertrag: Bei wirklich gravierenden Mängeln ist sogar eine komplette Rückabwicklung des Geschäfts denkbar.
Der Haken an der Sache ist die Beweislast. Sie müssen nachweisen, dass der Verkäufer von dem Mangel wusste und ihn absichtlich unter den Teppich gekehrt hat. Das gestaltet sich in der Praxis oft extrem schwierig und kann zu langwierigen und teuren Rechtsstreitigkeiten führen.
Der beste Schutz vor bösen Überraschungen ist und bleibt eine gründliche Prüfung der Wohnung vor dem Kauf – am besten mit einem Bausachverständigen an Ihrer Seite. Jeder noch so kleine Mangel sollte dann direkt im Kaufvertrag vermerkt werden.
Wie setzen sich die Kaufnebenkosten genau zusammen?
Die Kaufnebenkosten sind der Posten, der am häufigsten unterschätzt wird. Sie kommen noch obendrauf zum eigentlichen Kaufpreis und müssen von Anfang an fest in Ihre Finanzierung eingeplant werden. Rechnen Sie je nach Bundesland mit 9 % bis 15 % des Kaufpreises. Das ist eine Hausnummer.
Hier eine Aufschlüsselung, wohin das Geld fließt:
- Grunderwerbsteuer: Das ist der mit Abstand größte Brocken. Die Höhe variiert je nach Bundesland erheblich und liegt zwischen humanen 3,5 % (in Bayern) und knackigen 6,5 % (z. B. in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg oder Schleswig-Holstein).
- Notar- und Grundbuchkosten: Für die Beurkundung des Vertrags und die Umschreibung im Grundbuch fallen Gebühren an. Als Faustregel können Sie hier mit etwa 1,5 % bis 2,0 % des Kaufpreises kalkulieren.
- Maklerprovision: War ein Makler im Spiel, möchte dieser natürlich auch entlohnt werden. Seit einer Gesetzesänderung Ende 2020 teilen sich Käufer und Verkäufer die Provision fair. Üblich sind für jede Seite 3,57 % des Kaufpreises (inklusive Mehrwertsteuer).
Bei einem Kaufpreis von 300.000 Euro in einem Bundesland mit 6,5 % Grunderwerbsteuer sind das schnell über 40.000 Euro an Nebenkosten. Diese Summe muss in aller Regel aus dem Eigenkapital gestemmt werden, da Banken sie nur sehr ungerne mitfinanzieren.
Was genau ist eine Auflassungsvormerkung?
Die Auflassungsvormerkung ist so etwas wie Ihr persönlicher Bodyguard im Kaufprozess. Sobald der Kaufvertrag beim Notar unterzeichnet ist, veranlasst dieser sofort die Eintragung dieser Vormerkung im Grundbuch.
Stellen Sie es sich wie eine felsenfest verbindliche Reservierung vor. Ab diesem Moment ist die Wohnung für Sie "geblockt". Der Verkäufer kann sie jetzt weder an einen anderen Interessenten verkaufen noch eine neue Hypothek darauf aufnehmen.
Die Auflassungsvormerkung schützt Sie in der sensiblen Phase zwischen Vertragsunterschrift und Ihrer endgültigen Eintragung als neuer Eigentümer. Dieser formale Akt kann nämlich durchaus einige Wochen oder sogar Monate dauern.
Erst wenn diese Vormerkung sicher im Grundbuch steht, gibt der Notar grünes Licht für die Zahlung des Kaufpreises. So ist garantiert, dass Ihr Geld erst dann fließt, wenn Ihr Anspruch auf die Immobilie rechtlich zementiert ist. Ein unverzichtbarer Schritt für einen sicheren und reibungslosen Kauf.
Wenn Sie vor dem Kauf einer Eigentumswohnung eine schnelle und fundierte Ersteinschätzung zu sichtbaren Mängeln benötigen, kann Ihnen bau24 helfen. Laden Sie einfach ein Foto des Schadens hoch und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten eine KI-gestützte Analyse, bevor Sie teure Gutachter beauftragen. Sichern Sie Ihre Kaufentscheidung ab und verschaffen Sie sich Klarheit unter: https://bau24.org